2010 Jahr der Breitblättrigen Stendelwurz/Sitter/Sumpfwurz
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Auswertung
Wiederum hat eine beachtliche Anzahl (64) unserer Kartierungsmitarbeiter/Innen das „Jahr der …“ aktiv unterstützt und mit ihren Rückmeldungen aus den Exkursionen oder Kontrollgängen wertvolle Daten zu einer aktuelleren, kompletteren Verbreitungskarte beigetragen. Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden.
In 336 RF/Q (Rasterfeld/Quadranten) sind unsere Leute im Laufe der Vegetationsperiode des Jahres 2010 unterwegs gewesen (davon 14 im grenznahen Ausland). Dabei sind 275 RF/Q aktualisiert worden. 14 bleiben leider unbestätigt. Was jedoch besonders erfreulich ist: In 100 RF/Q wurden Epipactis helleborine-Fundorte, die vor dem Jahr 2000 entdeckt worden waren, aktualisiert, und in 47 RF/Q sogar ganz neu nachgewiesen, ohne dass spezielle Informationen zu unbesetzten (leeren) RF/Q angefordert worden waren.
Alle genauen Details kann man im Mitteilungsheft 1/2011 nachlesen.
Biotope
Die Überprüfung der Fundmeldungen bestätigt weitgehend die in der Pflanzenbeschreibung aufgeführten potenziellen Wuchsorte: Waldränder generell, Böschungen und Ränder von Waldwegen oder Waldstrassen, über eine längere Zeitspanne nicht belegte Rundholzlagerplätze (hier kommt manchmal auch Cephalanthera rubra vor), Wasserlaufränder (im Wallis Bisse oder Suone), Aussenböschungen an Bächen, Hecken- und Gebüschränder, teilweise auch in Feuchtgebieten, helle Stellen im Wald (oft in Wegnähe). Im dunkleren Wald bleibt Epipactis helleborine vielfach steril.
Aus einigen Gebieten des Juras wurden Trockenheitsschäden gemeldet.
„Nullmeldungen“ bei ehemaligen Vorkommen sind wahrscheinlich mit folgenden Ereignissen zu begründen:
Strassenbau, Wegverbreiterung, Überwucherung nach Holzschlag oder Sturmschaden (Brombeeren, Brennnesseln, Disteln). Oft wird auch das zu frühe Mähen der Wegränder erwähnt. Manchmal ist aber auch kein offensichtlicher Grund für das Ausbleiben der Art auszumachen.
Verbreitung
Das Studium der neuen Karte zeigt Folgendes: Da Epipactis helleborine über 1800 m NN nur noch selten auftritt (höchster Fundort am Ofenpass bei 2200 m), werden vermutlich auch in Zukunft einige RF/Q in Graubünden, in der Zentralschweiz, im Berner Oberland, im Wallis sowie in Teilen des Tessins und der Waadtländer Alpen unbesetzt bleiben. Offensichtlich ist, dass die Art schweizweit verbreitet vorkommt. In der Nordostschweiz konnten etliche Lücken geschlossen werden, der Jurabogen ist nun fast komplett aktuell besetzt. Grössere Lücken sind noch immer in gewissen Geländeabschnitten des Mittellandes, wie z.B. im Dreieck Luzern-Langenthal-Lyss sowie im Raum vom SW-Ende des Murtensees bis gegen Rolle am Genfersee vorhanden. Dies wahrscheinlich wegen der in diesen Gebieten meist sehr intensiv betriebenen Bewirtschaftung der Böden. Deshalb sind hier günstige Nischen für eine Epipactis helleborine-Besiedelung ausgesprochen rar. In den in diesen Gegenden wachsenden Wäldern könnte man aber bei gezielter Suche wahrscheinlich doch noch ein paar Verbreitungslücken schliessen.
Gefährdung
Die Karte zeigt klar, dass die Gefährdung gering ist, da die Art weit verbreitet vorkommt. Trotzdem existieren konkrete Gefahren: Zu frühes und rigoroses Ausmähen der Waldwegränder und Waldwegböschungen kann die Bestände massiv beeinträchtigen. Die moderne Waldbewirtschaftung mit extrem schwerem Gerät ist als nicht besonders „orchideenfreundlich“ einzustufen. Zudem werden in gewissen Gegenden (z.B. March SZ) die Waldränder schon im Frühsommer bis zur ersten Baumreihe hin komplett „ausgeputzt“. Ein auch nur noch im Ansatz natürlicher Waldrand existiert an diesen Orten nicht mehr. Also fehlt hier für viele Pflanzen eine Existenzgrundlage fast total. Kommt hinzu, dass Orchideen in diesen meist nordexponierten, auf Nagelfluh wachsenden Hangwäldern ohnehin Mangelware sind. Auch intensive Freizeitaktivitäten in Waldrandnähe stellen eine gewisse Gefahr für einige Vorkommen dar.
Zusammenfassung
| Land/Kanton | Gemeinden | Fundorte (+) | Fundorte (-) |
| Frankreich | 8 | 12 | |
| Fürstentum Lichtenstein | 2 | 4 | |
| Italien | 2 | 3 | |
| Schweiz | 316 | 789 | 88 |
| Total: | 328 | 808 | 88 |
| Fundorte mit Negativmeldungen | 88 | ||
| Fundorte mit 1 bis 10 Exemplaren | 608 | ||
| Fundorte mit 11 bis 100 Exemplaren | 193 | ||
| Fundorte mit 101 bis 1000 Exemplaren | 7 | ||
| Fundorte mit mehr als 1000 Exemplaren | 0 | ||
Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, dass aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland 808 Fundortmeldungen mit wenigstens einer Pflanze eingegangen sind. Für 1% (7) der Fundorte werden 101-1000, für 24 % (193) 11-100 und für 75% (608) 1-10 Exemplare angegeben. Diese Zahlen sind insofern zu relativieren, weil sie ziemlich sicher in direktem Zusammenhang mit der Durchforschungsintensität in den verschiedenen Gebieten stehen. Bei der Durchsicht der Fundliste wurde festgestellt, dass Gebiete mit grösseren Beständen mehr punktuell existieren.
Abschliessend allen noch einmal ein grosses und herzliches „Dankeschön“ für den Einsatz im „Jahr der Epipactis helleborine 2010“. Wir freuen uns, wenn wir auch zukünftig auf eure aktive Mithilfe zählen dürfen.
Ruedi Irniger, Walter Schmid (Verantwortliche "Jahr der ...")
Beschreibung der Orchidee
Fotos: links Chr. Boillat, rechts Th. Ulrich
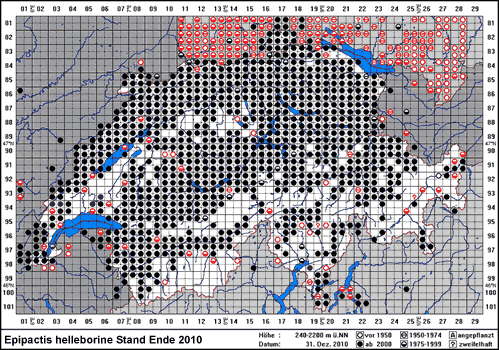
Klicken in die Graphik vergrössert die Abbildung.
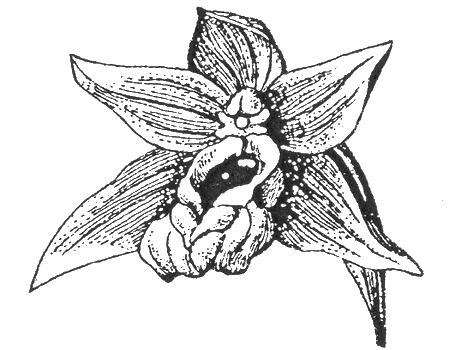
Alle Ergebnisse vom "Jahr der ..."
2001: Limodorum abortivum 2002: Epipactis atrorubens 2003: Jahr des Kanton Aargau 2004: Malaxis monophyllos 2005: Cephalanthera damasonium 2006/2007: Ophrys holoserica 2008/2009: Listera cordata 2010: Breitblättrigen Stendelwurz 2011/2012: Holunder-Fingerkraut 2013/2014: Fliegen-Ragwurz 2015: Langspornige Handwurz 2016/2017: Kugelorchis 2018: Männliches Knabenkraut 2019/20: 5 Wald-Epipactis-Arten 2021: Frauenschuh 2022: Einorchis 2023: Korallenwurz
Impressum & Datenschutz | Kontakt | Mail Webmaster | AGEO © 2024
Aktualisiert 07. 04. 2011
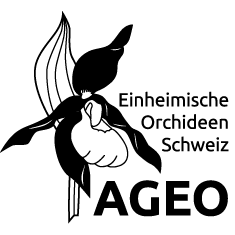 www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.
www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.  ausblenden
ausblenden